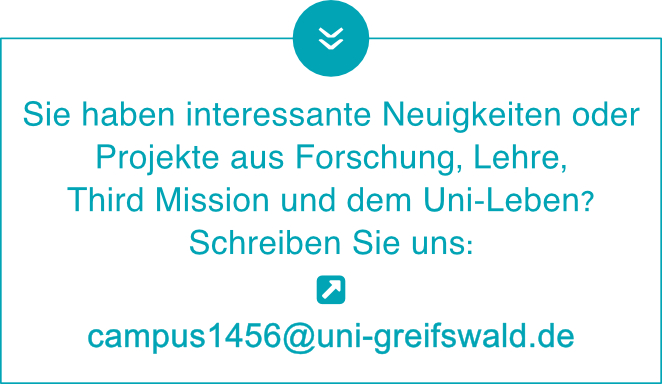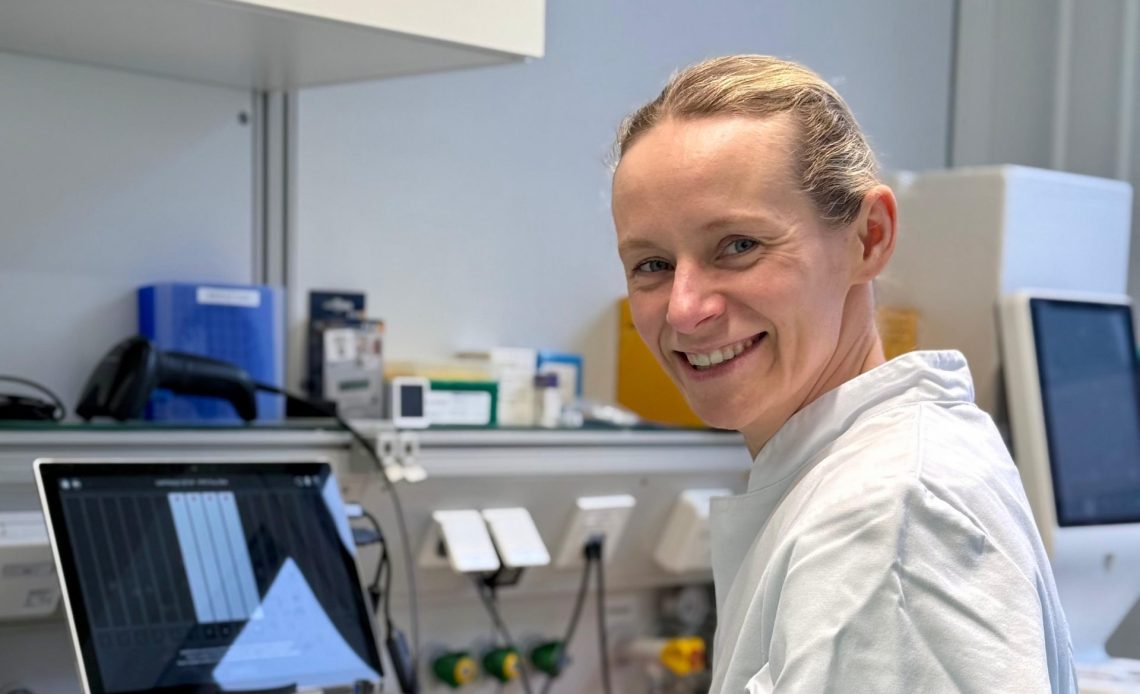
Josefine Radke, © Betty Nedow
Seit September 2021 ist PD Dr. Josefine Radke Neuropathologin an der Unimedizin Greifswald. Zu Ihren Schwerpunktgebieten gehört die Forschung zu Hirn-Metastasen. Aktuell beschäftigt sie sich mit dem Aufbau einer neuen Core Unit. Was das ist und inwiefern auch andere Fachbereiche der UMG künftig davon profitieren werden, darüber sprach sie mit der UMG-live.
Frau Radke, bevor Sie zur UMG gekommen sind, waren Sie zehn Jahre lang an der Charité Berlin. Was bewegte Sie zu einem Wechsel nach Greifswald?
Wenn man in der Forschung tätig ist, dann ist es nicht unüblich, die Häuser zu wechseln. Das kann auch mal einen Perspektivwechsel bewirken. Als Neuropathologin war es mir persönlich wichtig, mich breiter aufzustellen. In Greifswald konnte ich weiterhin in der Neuropathologie bleiben, aber zusätzlich meinen zweiten Facharzt in Pathologie machen. Dadurch kann ich im Forschungskontext Hautkrebs und Molekulardiagnostik beide Fächer vertreten.
Was haben Sie als Neuropathologin denn mit Hautkrebs zu tun?
Zu meinen Schwerpunkten gehört die Forschung an Melanommetastasen. Nicht selten bekommen Patient*innen mit schwarzem Hautkrebs nämlich auch Hirnmetastasen. Deshalb gehe ich der zentralen Frage nach, warum diese Zellen ins Hirn wandern. Werden dort Botenstoffe ausgeschüttet, die die Tumorzellen anlocken? Oder finden die Tumorzellen im Gehirn eine besonders gute Umgebung vor? Ich schaue mir daher nicht nur die Tumorzellen als solche an, sondern auch die Umgebungszellen, also das Mikromilieu. Und dieses Mikromilieu kann bewirken, dass aus einer sogenannten schlafenden Metastase eine wachsende wird. Das kann auch erst viele Jahre nach der Hautkrebsdiagnose passieren.
Das klingt sehr kleinteilig…
Das ist auch kleinteilig und braucht hochauflösende Methoden. Hier kommt die eben genannte Molekulardiagnostik ins Spiel. Es gibt beispielsweise Panel- und Exomsequenzierungen, Methylierungsanalysen und Spatial Transcriptomics. Das klingt ganz schön fachlich, aber im Grunde geht es dabei darum, genaue Genanalysen durchzuführen. Dabei schauen wir uns nicht nur an, welche Gene aktiv sind, sondern auch, in welcher räumlichen Position sie sich befinden. Ziel ist, dass man zum Beispiel die schlafenden Tumorzellen identifizieren kann, bevor sie geweckt werden und für den Patienten tödlich werden können. Das kann uns einen großen Schritt weiterbringen – und zwar in der gesamten Krebsforschung hinsichtlich Diagnose, Behandlung und auch Prävention.
Krebsforschung betrifft ja viele Fachbereiche. Stellen Sie denn auch eine Art Schnittstelle dar?
Noch nicht so sehr, wie es idealerweise sein sollte. Aber damit legen wir jetzt an der UMG los. Zusammen mit dem CCC-MV und der Klinik für Hämatologie und Onkologie bauen wir derzeit ein molekulares Tumorboard auf, das diese genauen Analysen von onkologischen Patient*innen begleiten wird. Und damit wir als kleinere Unimedizin die Analysen mit teuren Techniken durchführen können, bündeln wir künftig alle nötigen Ressourcen in einer Core Unit. Das heißt: Forschungsinfrastruktur an einem Ort und mit einem multidisziplinären Team aus Pathologie, Humangenetik, Molekulare Biologie, Biotechnologie und Bioinformatik. Die Core Uni betrifft im Übrigen nicht nur onkologische, sondern auch seltene Erkrankungen.
Das wird doch sicher teuer!
Ja, solch hochmoderne Techniken können mehrere Millionen kosten. Deshalb stehe ich momentan auch weniger im Labor, sondern sitze am Schreibtisch und schreibe Anträge, um Drittmittel einzuwerben. Und es geht voran: Wir sind zum Beispiel mit den Rostocker Kolleg*innen beim Exzellenforschungsprogramm weitergekommen. Das ist für uns eine große Chance.
Seit Kurzem gibt es auch ein neues Institut an der Unimedizin, in das die Core Unit eingebunden wird: das Institut für Molecular Genomics. Haben damit auch Studierende die Möglichkeit, diese Techniken kennenzulernen?
Auf jeden Fall! Die Studierenden haben nicht nur die Möglichkeit, die DNA- und RNA-Sequenzier- und Analysetechnologien kennenzulernen, sondern auch praktisch einzusetzen. Sie können also Geräte und Verfahren kennenlernen, die aktuell in der Spitzenforschung verwendet werden und erhalten so direkte Einblicke in die Technologien, die die molekulare Medizin in vielen Bereichen zukünftig prägen werden.
Am neuen Institut findet also auch Lehre statt.
Ja, das Institut für Molecular Genomics mit der Core Unit Genomics wird in die Lehre eingebunden. Es unterstützt sowohl bestehende Module als auch neue Kurse und Praktika, in denen Studierende den Umgang mit neuen Sequenzierplattformen, Probenvorbereitung und Datenanalyse kennenlernen.
Inwiefern haben Studierende auch die Möglichkeit, hier ihre Dissertation zu schreiben?
Es steht die notwendige Infrastruktur bereit, um Abschlussarbeiten und Dissertationen an hochaktuellen Fragestellungen – insbesondere in den Bereichen Onkologie und seltene Erkrankungen – durchzuführen. Unser Ziel ist dabei auch die Gewinnung, Förderung und das längerfristige Halten von wissenschaftlichem Nachwuchs am Standort Greifswald.
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei diesem großen Vorhaben!
Interview: Katrin Kleedehn
06.10.2025