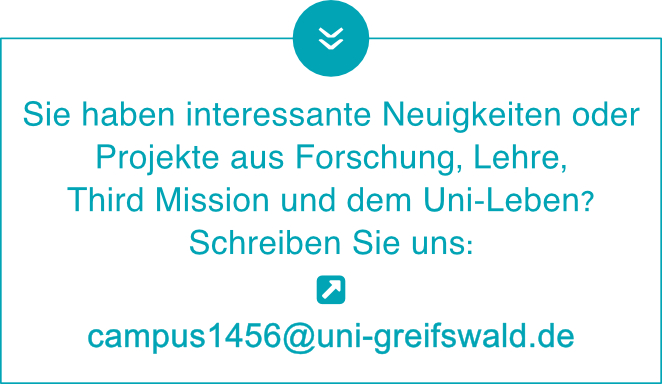Prof. Dr. Heide Volkening, © Gina Heitmann, Universität Greifswald
Sie liest Literatur nicht nur, sie untersucht sie – auf Struktur, Wirkung und gesellschaftliche Relevanz. Im Gespräch verrät Literaturwissenschaftlerin Prof. Dr. Heide Volkening, kürzlich zur Professorin ernannt, wie wichtig ihr kritisches Denken, wissenschaftliche Neugier und die Kraft irritierender Perspektiven sind.
Wie erklären Sie einem Laien Ihr Fachgebiet?
Ich lese aktuelle und historische Literatur und denke darüber nach, wie sie gemacht ist, welche Funktion sie hat oder nicht hat, wie sie rezipiert wird und wie sie erhalten und verbreitet werden kann.
Welche Herausforderungen sehen Sie aktuell für die Neuere deutsche Literatur und Literaturtheorie als wissenschaftliche Disziplin?
In den Philologien sind wir sicher besonders gefragt, was die Reflexion von KI und deren Nutzung in wissenschaftlichen Kontexten betrifft. Hier gibt es interessante Möglichkeiten zu entdecken und auch bedrohliche Verluste von Schreib- und Lesekompetenzen zu diskutieren. Mein Verständnis von Literaturwissenschaft speist sich ganz wesentlich aus der Überzeugung, dass Literatur einen verfremdeten Blick auf die historische und aktuelle Gegenwart erlaubt und dadurch Vergnügen schenken und Irritationen erzeugen kann, die kritisches Denken anregen. Wir sehen aktuell mit der globalen Bedrohung der Wissenschaftsfreiheit eine Gefahr für emanzipatorische Anliegen, wie etwa für die Gender Studies. Ich würde mir wünschen, dass dies im Fach breiter diskutiert würde.
Was ist Ihnen in der Lehre besonders wichtig?
Als Literaturwissenschaftlerin habe ich ja mit einem Gegenstand zu tun, der auch sehr stark mit Emotionen verbunden ist. Viele unserer Studierenden lesen sehr gern, aber vielleicht nicht unbedingt die Texte, die wir im Seminar diskutieren oder nicht auf die Weise, wie wir das methodisch und theoretisch vermitteln. Wenn es gelingt, dass Studierende mit leuchtenden Augen auf Texte schauen, die sie ursprünglich uninteressant fanden, ist das immer ein toller Moment. Wenn dann noch deutlich wird, dass sich dieser neue Blick auf den Text einer wissenschaftlichen Lektürepraxis verdankt, ist viel erreicht.
Leuchtende Augen von Studierenden sind für sie also ein zentraler Motor! Was macht Ihnen an der Arbeit mit Studierenden ferner sehr viel Freude?
Der Austausch – und dabei insbesondere die Situationen, in denen bei Studierenden eigenes Interesse, epistemologische Neugier und Begeisterung für etwas Neues zusammentreffen und dann auch artikuliert werden, sei es im Seminar, während der Sprechzeiten oder auch in Haus- und Abschlussarbeiten.
Welchen Tipp würden Sie Studierenden für ihr Studium und ihre Zukunft geben?
Lesen, lesen, lesen.
Was sind die wichtigsten Stationen in Ihrem Lebenslauf?
Zu den wichtigsten Stationen gehört sicher meine Zeit an der LMU München, während der ich meine Dissertation und Habilitation geschrieben habe. Prägend war aber mein Studium an der Universität Bielefeld, deren Gründung Teil der großen Bildungsoffensive in NRW war. Ihre Programmatik vereinte das, was wir heute exzellente Forschung nennen würden, mit einem Projekt der Chancengleichheit, die damals als aktive Rekrutierung der „Mädchen vom Lande“ verstanden wurde. Mentoring und Gleichstellung also bevor es diese an den Universitäten gab und gleichzeitig die Aufforderung und Möglichkeit, wissenschaftliche Exzellenz als interdisziplinäres Forschen zu erleben und in Studiengruppen auch selbst gestalten zu können.

Berufung zur Professur von Prof. Dr. Heide Volkening durch Dekan Prof. Dr. Jochen Müller, © Gina Heitmann, Universität Greifswald
Seit 2011 ist Prof. Dr. Heide Volkening wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für deutsche Philologie an der Universität Greifswald. Sie studierte von 1989-1997 Germanistik, Literaturwissenschaft, Philosophie und Pädagogik an der Universität Bielefeld, promovierte 2003 an der LMU München und arbeitete dort zwischen 2003 und 2011 als wissenschaftliche Assistentin am Institut für deutsche Philologie Im Februar 2025 erhielt sie den Professorentitel. Zwischen 2016 und 2024 war sie Mitglied im Vorstand des Interdisziplinären Zentrums für Geschlechterforschung (IZfG), seit 2019 als Vorstandssprecherin. Gegenwärtig forscht sie im Projekt Cringe. Ästhetik und diskursive Praxis der Schamlust (VW-Stiftung) und ist Teil des BMBF-geförderten Strukturprojekts Inklusive Exzellenz in der Medizin (InkE).
Interview: Wiebke Pförter
02.07.2025