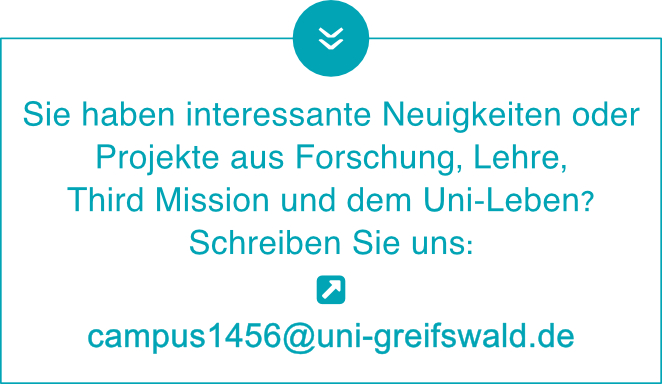Prof. Dr. Martin Siegel, © Gina Heitmann
Gesundheitsökonomie mag vielleicht nüchtern klingen, behandelt aber die existenziellsten Fragen: Wie verteilt man begrenzte Ressourcen so, dass alle eine faire Chance auf ein langes, gesundes Leben haben? Prof. Dr. Martin Siegel erklärt im Interview, wie seine Forschung helfen kann, Ungleichheiten zu erkennen und Versorgung weltweit gerechter zu gestalten.
Wie würden Sie Ihren Forschungsbereich jemandem erklären, der kein Vorwissen in Gesundheitsökonomie hat – etwa beim Abendessen mit Freund*innen?
Gesundheitsökonomie ist eigentlich ein Euphemismus, es ist vermutlich das morbideste Fach der Wirtschaftswissenschaften, das sich viel mit existenziellen Fragen von Krankheit und Tod – beziehungsweise deren Vermeidung und Behandlung trotz knapper Mittel – beschäftigt. Aber Scherz beiseite: Das übergeordnete Ziel meiner Forschung ist es, die vorhandenen Ressourcen für Prävention und Versorgung so zu verteilen, dass jeder Mensch eine faire Chance auf ein langes und gesundes Leben in Würde erhält. Dafür beschäftige ich mich beispielsweise mit Methoden zur Bewertung von Gesundheitssystemen. Das können sowohl Kennzahlen wie vorzeitige Sterblichkeit oder die Messung von Über-, Unter- und Fehlversorgung als auch direkte ökonomische Konsequenzen für Haushalte, etwa in Form von finanziellen Härten, sein. Ein weiterer Teil meiner Forschung beschäftigt sich mit der Bewertung von neuen Präventions- und Versorgungskonzepten. In den letzten Jahren habe ich mir beispielsweise ein Konzept für eine sicherere Medikation in der Altenpflege zur Vermeidung von gefährlichen Neben- und Wechselwirkungen angesehen und untersuche zurzeit die möglichen Vorteile von niederschwelligen Angeboten zur Stärkung der psychischen Gesundheit bei Jugendlichen.
Ihre Arbeit ist international ausgerichtet: Gibt es Länder oder Gesundheitssysteme, die für Sie besonders beeindruckend sind?
Gerade in der Zusammenarbeit mit ressourcenarmen Ländern im Rahmen der Forschung in den Bereichen Globale Gesundheit und Entwicklungszusammenarbeit beeindrucken mich der Pragmatismus und die Bereitschaft, neue Wege zu gehen, immer wieder. Die dortigen Gesundheitssysteme und deren Leistungsfähigkeit sind absolut gesehen vielleicht noch nicht mit denen in sehr reichen Ländern vergleichbar. In den letzten Jahren gab es aber eine deutliche Aufbruchstimmung, die dort zu teils rasanten Verbesserungen der Bevölkerungsgesundheit geführt hat. Wenn ich jetzt ein spontanes Beispiel nennen sollte, wäre das Ghana, das durch intensive Kooperation im Entwicklungsbereich, aber auch im wissenschaftlichen Bereich, einige Leuchtturmprojekte mit Bezug zur Gesundheitsversorgung geschaffen hat.
Sie haben kürzlich einen Kommentar im Lancet Regional Health Europe veröffentlicht, das sich mit Deutschlands Rolle in der globalen Gesundheitspolitik beschäftigt. Welchen Beitrag kann oder sollte Deutschland zur Förderung globaler gesundheitlicher Gerechtigkeit leisten?
In dem Kommentar ging es besonders um die Bedeutung der bilateralen und multilateralen Zusammenarbeit im Bereich Gesundheit und Entwicklung, um das Ziel 50-by-50, also die Reduzierung vorzeitiger Sterblichkeit um 50% bis zum Jahr 2050, zu erreichen. Ein Gerechtigkeitsaspekt liegt meines Erachtens besonders in der materiellen und immateriellen Unterstützung der ärmsten Länder. Das kann zum Beispiel die Bereitstellung von Medikamenten und Impfstoffen sein, die sich große Teile der Bevölkerung in ressourcenarmen Ländern sonst nicht leisten könnten. Ein weiterer wesentlicher Punkt ist aber, auch Themen wie Gendergerechtigkeit und Diversität in der gesundheitsbezogenen Entwicklungszusammenarbeit fortzusetzen. Die Förderung von Entwicklungen und Projekten in diesem Bereich dürfte vor dem Hintergrund der jüngeren politischen Entwicklungen im Kontext multilateraler Organisationen wie der Weltgesundheitsorganisation zunehmend schwieriger werden. Auch die Frage nach einer gerechten und für alle Einkommensgruppen leistbaren Finanzierung von Gesundheitssystemen ist ein Bereich, in dem die deutsche Perspektive und unsere Erfahrungen mit über 140 Jahren Erhalt und wiederholten Reformen der gesetzlichen Krankenversicherung stark nachgefragt sind – auch wenn diese hierzulande zurzeit ziemlich unter Druck ist.
Die Darstellung von Heterogenität ist ein zentrales Ziel Ihrer Forschung. Wie gelingt es, in komplexen Modellen Diversität sichtbar zu machen, ohne Menschen auf Zahlen zu reduzieren?
Sie sprechen mich hier auf einen Balanceakt der empirischen Forschung in Wirtschafts- und Sozialwissenschaften an. Durch die Verwendung statistischer Modelle läuft man natürlich immer ein bisschen Gefahr, Menschen auf Zahlen zu reduzieren – schließlich geht es um die Quantifizierung von Zusammenhängen und den Versuch, Muster zu identifizieren und verallgemeinerbare Aussagen zu treffen. Wichtig ist es, bei der Einordnung und Interpretation der Ergebnisse nicht aus den Augen zu verlieren, dass sie die Situation von Haushalten oder einzelnen Personen oder die Auswirkungen von bestimmten Entscheidungen, Ereignissen oder Behandlungen auf Menschen beschreiben. Man stellt sich bei der Auswertung also immer die Frage: Was bedeutet das für die Betroffenen? Eine weitere große Herausforderung liegt darin, sinnvolle Gruppen zu definieren. Wo erwarte ich für meine Fragestellung relevante Unterschiede? Welche Gruppen kann ich in meiner Untersuchung „über einen Kamm zu scheren“? In den Bereichen maschinellen Lernen und Data Science finden sich dafür datengetriebene Methoden, die Wirtschafts- und Sozialwissenschaften neigen eher zu theorie- beziehungsweise hypothesenbasierten Ansätzen. Beides hat seine Vor- und Nachteile.
Ein weiteres Forschungsinteresse von Ihnen sind vermeidbare gesundheitliche Ungleichheiten. Was bedeutet es für Sie, „vermeidbare“ Ungleichheiten zu erforschen – und wie definieren Sie, was vermeidbar ist und was nicht?
Vermeidbare Ungleichheit ist ein Konzept aus der Gesundheitsökonomie, mit dem man versucht, „ungerecht“ von „ungleich“ zu unterscheiden. Nicht alles, was ungleich ist, ist ungerecht. Und nicht alles, was gleich ist, ist gerecht. Nehmen wir ein Beispiel: Wenn ich die Gesundheitsversorgung von zwei Gruppen vergleiche, die die gleichen Krankheiten in der gleichen Schwere haben, ist vermutlich, stark vereinfacht, jede Ungleichversorgung ungerecht: Gleicher Bedarf soll gleich versorgt werden. Zeigt sich aber eine unterschiedlich gute Versorgung, etwa so, dass eine Gruppe mehr und bessere Versorgung mit besseren Erfolgsaussichten bekommt als die andere, wäre das eine durch politische oder finanzielle Eingriffe vermeidbare Ungleichheit, die – in einem egalitären Gerechtigkeitsparadigma – als ungerecht betrachtet würde. Eine häufige Fragestellung ist dann: Was, wenn nicht die Gesundheit, erklärt Unterschiede in der Versorgung? Ähnliche Fragestellungen ergeben sich bei der Verteilung von Gesundheit beziehungsweise Krankheit. Wenn sich alterstypische Krankheiten wie Bluthochdruck oder Diabetes im selben Alter in bestimmten Einkommensgruppen häufen, sollte das durch Verhältnis- und Verhaltensprävention vermeidbar sein.
Sie beschäftigen sich täglich mit strukturellen Problemen – wie bewahren Sie sich dabei Ihren Optimismus?
Ich habe das unermessliche Privileg, mit jungen Menschen zusammenzuarbeiten, die diese strukturellen Probleme sehen und Dinge verändern wollen. Das sind sowohl meine Studierenden, die durchaus eine Sensibilität für diese Themen mitbringen, als auch meine Mitarbeitenden, die sich in ihren Forschungsarbeiten damit beschäftigen. Mit diesen Menschen im nationalen und internationalen Kontext nicht nur Probleme zu beschreiben, sondern an Lösungen zu arbeiten, zeigt mir regelmäßig, dass Veränderungen und Verbesserungen möglich sind.
Und wie motivieren Sie Studierende, sich mit struktureller Ungleichheit zu beschäftigen, ohne dabei den Mut zu verlieren?
Die Studierenden, die sich im Rahmen von Vorlesungen, Seminaren, Abschlussarbeiten und natürlich später auch in ihren Promotionen mit diesen Themen beschäftigen, kommen schon mit einer starken Eigenmotivation. Die Kunst ist es eher, diese Motivation aufrecht zu erhalten und keine Resignation aufkommen zu lassen. Das Fokussieren auf Konzepte und Maßnahmen zur Verbesserung der Situation von benachteiligten Gruppen hilft sehr dabei, die Motivation – auch meine eigene – aufrecht zu erhalten. Besonders dann, wenn diese Konzepte sich in gesundheitsökonomischen Evaluationen als wirksam erweisen.
Prof. Dr. Martin Siegel ist seit Juli 2025 Professor für Allgemeine Volkswirtschaftslehre, Gesundheitsökonomie und Ökonometrie. Er erforscht Ursachen gesundheitlicher Ungleichheiten und entwickelt Strategien für eine gerechte und effiziente Gesundheitsversorgung.
Bevor Prof. Dr. Martin Siegel an die Uni Greifswald kam, promovierte er an der Universität zu Köln und arbeitete von 2012 bis 2018 als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Berlin. Ab 2018 war er dort als Juniorprofessor für Empirische Gesundheitsökonomie tätig und schloss im Oktober 2024 seine Habilitation im Fach Public Health ab.
Interview: Wiebke Pförter
10.10.2025