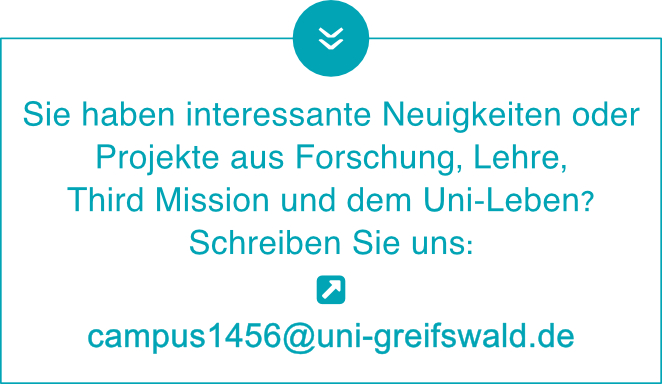Amerikanistik-Studierende präsentieren ‚Goldenes Zeitalter‘ multimedial
Im Rahmen ihres Bachelorstudiums haben 16 Studierende der Amerikanistik ein Digitalprojekt realisiert. Unter dem Titel „What in the Gilded Age. Gossip and Scandal in New York’s High Society“ erarbeiteten sie eine interaktive Onlinepräsentation zu Fragen von Prominenz, Geschlechterrollen und Medienkultur um 1900. Mit Hilfe von Quizzes, Karten, Instagram-Accounts, Graphen und Blogs machen die Studierenden historische Quellen zugänglich und zeigen auf, wie spannend historische Printmedien als Quelle kulturwissenschaftlicher Analysen sein können.
Die Studierenden beschäftigten sich unter der Leitung von Prof. Dr. Katrin Horn mit der Zeitschrift Town Topics. The Journal of Society (1883–1930). Die Zeitung umfasste Literatur- und Theaterkritiken, Börsennachrichten sowie Gedichte und Witze. Doch das berüchtigte Herzstück war eine Klatsch- und Skandalrubrik über die High Society New Yorks. „Diese Texte liefern nicht nur biografische Details zu berühmten Persönlichkeiten, sondern erlauben auch Einblicke in die Entstehung von Celebrity-Kultur, in gesellschaftliche Leitbilder von Geschlecht und Sexualität sowie in den Aufstieg einer wohlhabenden, freizeitorientierten Oberklasse („leisure class“) – Themen, die auch in aktuellen Debatten über ein ‚zweites Goldenes Zeitalter‘ in den USA wieder von Relevanz sind“, ordnet Prof. Dr. Katrin Horn das Medium ein.
Das Goldene Zeitalter bezeichnet einen Zeitraum in der Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika (USA), der sich über die letzten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts, die Jahrhundertwende und die ersten Jahre des 20. Jahrhunderts erstreckt. Nachdem sich das Land gerade vom Bürgerkrieg (1861–1865) und der anschließenden Zeit des Wiederaufbaus erholt hatte, erlebte es einen enormen wirtschaftlichen, industriellen und technischen Fortschritt, wie den Ausbau der Eisenbahn, die Einführung der elektrischen Beleuchtung, die Erfindung des Telefons und einen erheblichen Anstieg der Löhne. Unter den zahlreichen Reformbemühungen im sozialen und politischen Kontext führte dies zur Entstehung der Konsumkultur, der Freizeitklasse, der Promi-Kultur und des auffälligen Konsums – beispielhafte Merkmale, die weitgehend mit der sogenannten High Society zu tun hatten.
Die Studierenden erarbeiteten sich zunächst die historischen und medialen Grundlagen, von Strategien im Umgang mit Zeitungen des 19. Jahrhunderts bis hin zur rechtlichen Diskussion um Privatsphäre. Darauf aufbauend entwickelten sie eigene Forschungsfragen und setzten ihre Ergebnisse in digitale Projekte um. Ziel dabei war dezidiert nicht eine wissenschaftliche Darstellung, sondern ein Ergebnis, was für die breite Öffentlichkeit das Thema ansprechend darstellt.
Fünf ausgewählte Projektergebnisse im Überblick
Das Projekt „Selling Status“ untersucht die Entwicklung der Werbung in der Zeitschrift Town Topics zwischen 1887 und 1906 und zeigt, wie Anzeigen soziale Werte, Statusverhalten und Konsumkultur der Gilded Age widerspiegelten. Es interpretiert Werbung nicht nur als kommerzielle Inhalte, sondern als kulturelle Dokumente, die gesellschaftliche Veränderungen in Konsum, Identität und Medienrepräsentation sichtbar machen. Dabei wird deutlich, dass Anzeigen eine parallele Erzählung von aspirativem Konsum und sozial codierter Botschaft entfalteten und so entscheidend zum kulturellen Profil der Zeitschrift beitrugen.
https://towntopics-project.com/projects/on-town-topics/selling-status/
Town Topics diente zwischen 1885 und 1937 als Mittel der gesellschaftlichen Kontrolle durch Klatsch und Spott. Die Zeitschrift überwachte das Verhalten der Oberschicht, besonders das von Frauen, und sanktionierte modische oder soziale Grenzüberschreitungen. Im Licht theoretischer Ansätze von Maureen E. Montgomery und Thorstein Veblen zeigt sich, wie Town Topics Klassengrenzen festigte, Werte der Elite widerspiegelte und ein Idealbild der wohlhabenden Frau in der Gilded Age prägte.
https://towntopics-project.com/projects/how-to-be-a-proper-member-of-high-society/hemlines-headlines/
Das „Foreign Hotel Directory“ von Town Topics entwickelte sich 1913/14 rasch zu einem festen Anzeigenblock für europäische Hotels, brach jedoch mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs abrupt ein. Anhand der sinkenden Zahl und des Verschwindens dieser Anzeigen lässt sich die unmittelbare Auswirkung des Krieges auf internationale Reisen und deren Darstellung in der Zeitschrift nachvollziehen. Neben den Hotelanzeigen spiegelten auch andere Rubriken wie „Saunterings“ oder „Americans Abroad“ die durch den Krieg veränderten Mobilitäts- und Reisemuster wider.
https://towntopics-project.com/projects/developing-social-attitudes/influence-of-ww-i/
Alice Roosevelt, die älteste Tochter von Präsident Theodore Roosevelt, wurde bereits als Jugendliche zu einer nationalen und internationalen Berühmtheit. Ihr außergewöhnlicher Aufstieg zur „First Daughter“-Ikone wurde sowohl in seriösen Zeitungen wie der New York Times als auch in Klatschblättern wie Town Topics breit diskutiert. Das Projekt untersucht zentrale Momente ihrer Karriere und zeigt, wie unterschiedliche Medien ihre öffentliche Wahrnehmung prägten – bis hin zu Skandalen und rechtlichen Auseinandersetzungen.
https://towntopics-project.com/projects/creating-the-public-figure/roosevelt/
Der Konsum von Opium war im 19. und 20. Jahrhundert auch in der New Yorker High Society ein kontroverses Thema und fand in *Town Topics* regelmäßig Erwähnung – von Anzeigen und Theaterkritiken bis hin zu Skandalen. Während frühe Ausgaben den Gebrauch oft noch belustigt darstellten, änderte sich die Darstellung mit wachsender staatlicher Regulierung und der Anerkennung von Abhängigkeit als Krankheit. Nach dem Harrison Narcotic Act von 1914 erscheint Opium in der Zeitschrift schließlich weniger als reales Alltagsproblem, sondern eher als nostalgisch-verklärtes Symbol einer vergangenen, verrufenen Epoche.
https://towntopics-project.com/projects/developing-social-attitudes/opium/
Die Arbeiten der Studierenden lassen sich in vier Kategorien aufteilen:
- Klatsch als Quelle biographischer Analysen. Das Digitalproject versammelt Antworten auf die Fragen: Wie nahm die Öffentlichkeit einen Mord in der high society wahr? Wie verhielten sich Fans um 1900 gegenüber ihrer favorisierten Theaterschauspielerin? Was wurde über die Tochter des Präsidenten geschrieben? Und was machte eines der ersten It Girls aus?
- Neue Erkenntnisse über Town Topics selbst. Studienprojekte stellen heraus, wie Marketingkampagnen sich in Richtung lifestyle-orientiertem Konsum entwickeln, wie das Magazin sich von zeitgenössischen Debatten um das Recht auf Privatheit abgrenzt und wie schließlich verschiedene Gerichtsurteile das Ende von Town Topics einläuten.
- Verschiebungen im Sozialgefüge des Gilded Age. Projekte in diesem Themenspektrum zeichnen nach, wie sich die Wahrnehmung von Drogenkonsum verschiebt, was die Berichterstattung um psychische Probleme beeinflusst, ab wann sich die Unterschiede zwischen gesellschaftlicher Elite und Neureichen abschwächt, und welche Bedeutung der Erste Weltkrieg für die US-amerikanische Oberschicht hat.
- Möglichkeiten und Grenzen des Sozialen Aufstiegs. In diesen Projekten steht die Funktion von Klatsch als sozialer Kontrolle und Mittel zur Gruppenzugehörigkeit im Vordergrund. Sie erlauben dadurch Einblicke in die Idealvorstellungen der bürgerlichen Oberklasse bezüglich Verhalten, Kleidung, Freizeitgestaltungen und Geschlechterrolle.
„Neben intensiver Quellenarbeit lag der Fokus auf Projektmanagement, redaktioneller Zusammenarbeit und der Aufbereitung wissenschaftlicher Inhalte für eine allgemeinverständliche Website“, erklärt Katrin Horn den didaktischen Ansatz. In einer gemeinsamen Abschlussveranstaltung waren Studierende entsprechend aufgerufen, über ihre Beiträge sowie deren Entstehungsprozesse zu reflektieren.

„Besonders erfreulich war hierbei, dass die Seminarteilnehmer*innen sich zu einem Team entwickelt hatten, in dem sich Alle konstruktives Feedback gaben und sich für die gegenseitige Unterstützung bedankten. Auch das stärkere Bewusstsein für die Schwierigkeiten, aber auch Möglichkeiten digitaler Wissenschaftskommunikation, stellten die Teilnehmer*innen heraus – und die neu gewonnene Begeisterung für den Forschungsgegenstand“, fasst Katrin Horn zusammen.
Die Studierenden gestalteten eine umfangreiche digitale Publikation, die sowohl ihre Forschungsarbeit als auch ihre Auseinandersetzung mit digitalen Werkzeugen kreativ dokumentiert. „Für mich war die intensive Zusammenarbeit innerhalb der Gruppe und die Möglichkeit, mit neuen Darstellungsformen jenseits klassischer wissenschaftlicher Texte zu experimentieren, besonders“, resümiert Horn.
Das Projekt „What in the Gilded Age. Gossip and Scandal in New York’s High Society“ entstand im Modul „Applied Studies“, das Studierende im fünften Fachsemester des Studiengangs Amerikanistik absolvieren. Es verbindet ein seminaristisches Grundlagenstudium im Wintersemester mit einer praxisorientierten Projektarbeit im Sommersemester. Ziel ist es, wissenschaftliche Erkenntnisse für ein breiteres Publikum aufzubereiten.
Text: Elisabeth Böker, 19.9.2025