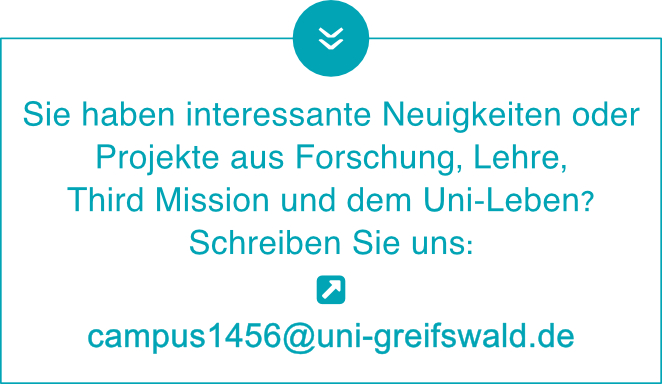Portrait Prof. Dr. Elisabeth Flucher, © Gina Heitmann, Universität Greifswald
Warum die Neuere deutsche Literatur heute gefragter ist denn je
Was verraten uns historische Texte über die Welt, in der wir heute leben? Und wie können junge Menschen wieder Zugang zu ihnen finden? Prof. Dr. Elisabeth Flucher, Juniorprofessorin für Neuere Deutsche Literatur, spricht über die Rolle der Literatur im 21. Jahrhundert.
Was reizt Sie besonders an der Neueren deutschen Literatur (NDL) als Forschungs- und Lehrgebiet?
Die NDL ist ein breites Fachgebiet, in dem sehr vieles an Forschungsschwerpunkten möglich ist: von der Frühen Neuzeit bis zur Gegenwart, von Handschriften bis Social-Media-Literatur. Die Literaturwissenschaft ist theoretisch unglaublich aufgeschlossen und ermöglicht sehr viel an Interdisziplinarität. Ich glaube, es ist ein Fach, in dem man als Geisteswissenschaftler*in experimentieren und sich austoben kann. An der Lehre reizt mich besonders, immer wieder gezwungen zu sein, etwas Aktuelles und Interessantes an historischen Texten zu finden, Bezüge zur Gegenwartskultur herzustellen und über überraschende neue Gegenstände mit Studierenden ins Gespräch zu kommen.
Welche literarischen Strömungen oder Diskurse der Neueren deutschen Literatur halten Sie derzeit für besonders relevant – auch im Hinblick auf aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen?
Aktuell beobachten wir natürlich alle gespannt die rasanten Entwicklungen in der KI-Forschung und Anwendung. Möglicherweise erleben wir da gerade eine mediale Revolution und einige meiner Kolleg*innen im Fach beschäftigen sich genau damit. Es gibt aber noch andere wichtige Themen, eines ist die aktuell ständig diskutierte Gefährdung der Demokratie. Im Prinzip sind es immer wieder Fragen danach, wie wir als Gesellschaft zusammenleben wollen. Ich denke, dass die Geisteswissenschaften hier enorm Wichtiges beitragen können, nicht nur an Gesellschaftskritik im engeren Sinn, sondern auch an einer fundierten Reflexion unserer Lebensformen, unserer Sprache, Kultur und Medien in historischer Perspektive. Das Thema Gesundheit, und besonders ‚Mental Health‘, scheint mir aber auch ein Dauerbrenner zu sein. Da gibt es in den ‚Medical Humanities‘ einiges an Potenzial. Hierzu gibt es auch in Greifswald ein Forschungsnetzwerk, an dem ich mich beteilige.
Wie hat sich der Blick auf klassische Texte Ihrer Meinung nach in den letzten Jahren verändert – etwa durch feministische oder postkoloniale Perspektiven?
Feministische und genderkritische sowie postkoloniale Perspektiven sind aus der Literaturwissenschaft nicht mehr wegzudenken, und das ist gut so. Das macht sich etwa daran bemerkbar, dass wir diese theoretischen Zugänge als grundlegend betrachten und sie in den Einführungen unterrichten. Es gibt immer wieder neue Theorien und Zugänge, und ich empfinde das als sehr bereichernd. Dennoch ist es weiterhin eine wichtige Aufgabe, die Stimmen von Frauen, LGBTQA+, BIPoC und Migrant*innen zu berücksichtigen und unseren literarischen und theoretischen Kanon stetig zu erweitern bzw. offen zu halten.
Viele junge Menschen tun sich heute – auch durch die Schnelllebigkeit von Social Media – schwer damit, sich auf längere, anspruchsvolle Texte zu konzentrieren, besonders wenn es sich um ältere Literatur handelt. Was würden Sie Studierenden raten, um dennoch einen Zugang zu diesen Texten zu finden?
Ich habe im Gegenteil den Eindruck, dass Studierende gerne und viel lesen (oder auch Hörbücher hören), aber dass ihre Lektüren häufig nicht Teil unseres Lehrkanons sind. Ich rate meinen Studierenden, ihre Begeisterung am Lesen unbedingt zu kultivieren, sich im Studium aber auch auf Neues, Fremdes und Ungewohntes einzulassen (das sind für die Studierenden meistens historische Texte). Umgekehrt wünsche ich mir aber auch, dass Studierende sich trauen, ihre Interessen in die Seminare einzubringen und darüber, was wir in den Seminaren lesen sollten, mit den Dozierenden in Austausch und Verhandlung zu treten.
Welche*n Autor*in würden Sie gerne einmal zum Abendessen treffen – und warum?
Gerade bereite ich eine Tagung zu Rahel Levin Varnhagen (1771–1833) vor und habe sehr viel Biographisches über sie gelesen. Sie war nicht nur eine glänzende Philosophin und Schriftstellerin, sondern auch eine unglaublich gewitzte Gesprächspartnerin. Unterhaltungen mit ihr werden als geistige Feuerwerke beschrieben. Das hätte ich sehr gerne erlebt, auch wenn die Gefahr bestünde, von ihrem scharfen Urteil bei der ersten Begegnung vernichtet zu werden. Ob sie auch mit mir zu Abend essen würde, bleibt also sehr ungewiss oder enthält zumindest ein gewisses Risiko, aber ich hätte sie unglaublich gerne an einem geselligen Abend erlebt.
Seit dem 01.04.2025 hat Prof. Dr. Elisabeth Flucher die Juniorprofessur für Neuere deutsche Literatur an der Universität Greifswald inne. Dabei vertritt sie innerhalb der NDL den Schwerpunkt Frühe Neuzeit (16.–18. Jahrhundert). In dieser Epoche ist auch ihr aktuelles Habilitationsprojekt angesiedelt. Darin erforscht sie „Schreibweisen der Hypochondrie (1670–1830)“ und fragt danach, wie sich medizinisches Wissen und Literatur gegenseitig inspirieren.
Bevor Prof. Dr. Elisabeth Flucher nach Greifswald kam, arbeitete sie zwischen 2021 und 2025 als Wissenschaftliche Mitarbeiterin (Post-Doc) bei Prof. Dr. Nacim Ghanbari am germanistischen Seminar der Universität Siegen und zwischen 2018 und 2021 als Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Neuere Deutsche Literatur am Institut für Germanistik der Universität Osnabrück. Dort promovierte sie außerdem zwischen 2015 und 2021 mit einer Dissertation mit dem Titel „Formen der Sinnkonstruktion in Nietzsches ‘Also sprach Zarathustra’“.
Interview: Wiebke Pförter
28.07.2025