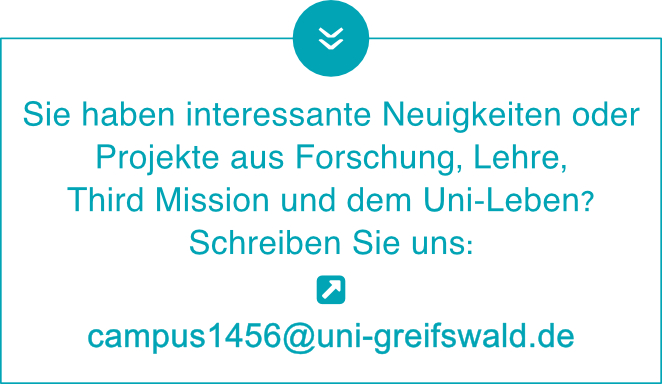Prof. Dr. Wolfgang Kesselheim, © Kilian Köthe, Universität Greifswald
Von Spanien- und Lateinamerikastudien über Kommunikation in Museen bis hin zur linguistischen Gesprächsanalyse mithilfe von 3D-Bewegungstracking. Klingt für Sie total zusammenhangslos? Nicht für Prof. Dr. Wolfgang Kesselheim. Zu alldem hat er in seinem Leben bereits geforscht. Heute gibt er sein Wissen als Dozent an der Universität Greifswald weiter.
Was sind die wichtigsten Stationen in ihrem Leben?
Bevor ich zur deutschen Sprachwissenschaft gekommen bin, habe ich in Bielefeld Spanien- und Lateinamerikastudien studiert. Hier habe ich auch promoviert, und zwar zum argentinischen Einwanderungsdiskurs. Ich habe untersucht, wie in Alltagsgesprächen ein Bild von ethnischen und nationalen Wir- und Fremdgruppen gezeichnet wird und wie dieses Bild dann argumentativ genutzt wird, um für die Legalisierung oder Ausweisung irregulärer Migrant*innen zu argumentieren.
Nach Zwischenstopps in Mannheim und Bayreuth habe ich dann an der Universität Zürich zur Kommunikation in Museen habilitiert und parallel dazu das VideoLab im Universitären Forschungsschwerpunkt „Sprache und Raum“ aufgebaut, wo es um die Frage ging, wie man die linguistische Gesprächsanalyse mit aktuellen Forschungsmethoden wie Videoanalyse, mobilen Eye-Tracking-Brillen oder 3D-Bewegungstracking unterstützen kann. In Zürich habe ich auch Forschungsprojekte im Swiss Science Center Technorama geleitet, wo wir uns angeschaut haben, wie Menschen in einem modernen ‚interaktiven‘ Museum Naturphänomene erfahren.
Seit gut zwei Jahren bin ich nun in Greifswald, wo mein Fokus auf der Lehre liegt. Hier versuche ich, den Studierenden das weiterzuvermitteln, was ich in der Forschung gelernt habe.
Wie erklären Sie einem Laien die Sprachwissenschaft als Fachgebiet?
Die Sprachwissenschaft interessiert sich für alles, was mit Sprache zusammenhängt. Wie wir mit Sprache Wissen vermitteln, wie wir in einer mehrsprachigen Gesellschaft mit Sprache umgehen, wie unser heutiges Deutsch entstanden ist, wie wir Vorurteile sprachlich ausdrücken, warum Sätze mehr sind als bloß ein ‚Sack mit Wörtern‘, wie gesprochene Sprache mit anderen körperlichen Ausdrucksmitteln wie Blicken oder Gesten verbunden ist und so weiter und so weiter.
Welche Herausforderungen sehen Sie aktuell für Ihr Fach als wissenschaftliche Disziplin?
Da sehe ich drei Herausforderungen.
Die Arbeit mit großen Sprachkorpora und deren digitalisierte Auswertung hat einen großen Sog entwickelt. Durch die automatisierte Abfrage geht aber oft der Kontext verloren, der zur Bedeutung einer sprachlichen Form beiträgt. Hier ist die Herausforderung, die neuen quantitativen Methoden produktiv mit den qualitativen Methoden zu verbinden, die für unser Fach so charakteristisch sind: die kleinschrittige Interpretation und die präzise, relevante Kontexte erschließende Lektüre.
Außerdem ändert KI im Moment massiv die Art und Weise, wie wir Texte schreiben und lesen (lassen). Hier muss die Sprachwissenschaft herausfinden, welche neuen Kompetenzen und neue Schreibpraktiken wir ausbilden müssen, damit Menschen zusammen mit KI Texte generieren können und dabei nicht verlernen, Textstrukturen zu verstehen.
Schließlich sind wir durch die aktuelle Lehramtsreform vor die Herausforderung gestellt, noch stärker als bisher darüber nachzudenken, wie wir die schulische und gesellschaftliche Relevanz unseres Fachs aktiv vermitteln können.
Was ist Ihnen in der Lehre besonders wichtig?
Ich möchte abwechslungsreiche Themen anbieten, damit die Studierenden erfahren können, wie thematisch breit die Linguistik aufgestellt ist. Dieses Semester geht es von „Guten Gesprächen in der Medizin“ über die Beschäftigung mit aktuellen und historischen Reiseführern bis hin zur Beschäftigung mit individueller und gesellschaftlicher Mehrsprachigkeit.
In den Seminaren versuche ich, möglichst viel Interaktion zu ermöglichen. Man lernt am meisten, wenn man sich über Texte austauscht oder in der gemeinsamen Beschäftigung mit Datenausschnitten versucht, anderen die eigene Sichtweise verständlich zu machen und gleichzeitig die Sicht der anderen nachzuvollziehen.
Was macht Ihnen an der Arbeit mit Studierenden am meisten Freude?
Ich freue mich immer, wenn Studierende Spaß an dem speziellen linguistischen Blick auf sehr kleine sprachliche oder nonverbale Phänomene der Kommunikation bekommen haben und in kleinen Gesprächs- oder Textausschnitten unheimlich viel entdecken. Oder wenn Studierende zurückmelden, dass sie auf einmal in ihrem Alltag Phänomene wiederfinden, die sie in unseren Seminaren kennen gelernt haben.
Welchen Tipp würden Sie Studierenden für ihr Studium und ihre Zukunft geben?
Wenn man es mit den zwölf oder dreizehn Jahren Schule vergleicht, merkt man, wie kurz das Studium eigentlich ist. Mein Tipp: Diese Zeit möglichst intensiv nutzen! Wahrscheinlich werden Sie nie mehr so viel Zeit am Stück haben, um sich gründlich in eine Sache zu vertiefen. Und: Nutzen Sie die Zeit nicht nur für das Studium „im stillen Kämmerlein“, sondern auch, um mit anderen ins Gespräch zu kommen. Nicht nur, um sich zu vernetzen, sondern auch, um gemeinsam zu erproben, wie man fachliche Ideen miteinander austauschen und Erkenntnisse vorantreiben kann.
Prof. Dr. Klaus Wolfgang Kesselheim wurde zu Jahresbeginn zum Professor ernannt. Er ist seit 2022 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Deutsche Philologie der Universität Greifswald.
Zwischen 1988 und 1996 absolvierte er das Studium der Spanien- und Lateinamerikastudien an der Universität Bielefeld mit den Nebenfächern Germanistik und Soziologie. 2003 promovierte Prof. Dr. Kesselheim zu Prozessen der Gruppenkonstitution im gegenwärtigen argentinischen Einwanderungsdiskurs und arbeitete anschließend an verschiedenen Forschungsprojekten an der Universität Mannheim und Universität Zürich. Sein Forschungsschwerpunkt lag dabei vor allem in der Text- und Gesprächslinguistik.
Interview: Wiebke Pförter
25.06.2025