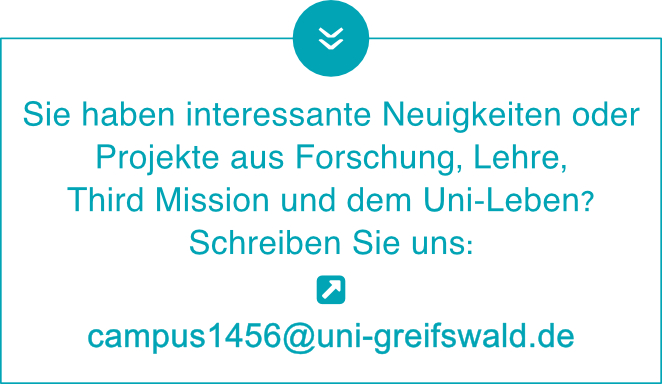Der „kleine“ Unterschied kann Leben retten: Interview mit
Prof. Dr. Sylvia Stracke
„Inklusive Exzellenz in der Medizin”, kurz InkE, heißt ein neues Projekt der Universitätsmedizin Greifswald und der Universität Greifswald. Dieses will den Aspekt des Geschlechts mehr ins Bewusstsein von Nachwuchswissenschaftler*innen rücken und so direkte Auswirkungen auf die Behandlungspraxis herbeiführen. Initiiert wurde das Projekt von Prof. Dr. Sylvia Stracke, der kommissarischen Leiterin der Inneren Medizin A. Die Kommunikationsabteilung der UMG hat
Prof. Dr. Stracke zu InkE befragt.
Frau Prof. Stracke, wie kam es zu InkE?
Hintergrund von InkE ist die Tatsache, dass in der medizinischen Grundlagenforschung oft ein sogenannter impliziter Bias vorherrscht, wenn es um die Analysevariable Geschlecht geht. Das bedeutet, dass das Geschlecht bei vielen Untersuchungen gar keine Berücksichtigung findet. Es geschieht nicht selten automatisch und unbewusst, aber führt zu einem blinden Fleck, der in der Behandlungspraxis fatale Folgen haben kann.
Wie zum Beispiel?
Ein beliebtes Beispiel ist der Herzinfarkt. Mittlerweile wissen wir, dass sich der Herzinfarkt bei Frauen anders äußert als bei Männern. Auch die Behandlung eines Herzinfarkts beruhte für eine lange Zeit auf Studien zu Medikamenten, die ausschließlich an männlichen Probanden durchgeführt wurden. Dabei benötigen Frauen eine andere Dosierung der Medikamente. Teilweise waren die Medikamente bei Frauen nicht gleich gut wirksam.
Geht es hier also um die Benachteiligung von Frauen?
Nein. Es kann ebenso umgekehrt der Fall sein, dass Männer keine Beachtung finden. Depressionen zum Beispiel äußern sich bei Männern anders als bei Frauen und bleiben deshalb nicht selten unbemerkt. Das führt dazu, dass Suizide aufgrund von Depressionen bei Männern häufiger sind als bei Frauen. Bei Depressionen muss man auch bedenken, dass nicht nur die Symptomatik unterschiedlich ist, sondern auch die jeweiligen genetischen Grundlagen. Diese Beispiele zeigen, dass eine exzellente Forschung mit einer realitätsabbildenden Datengrundlage zu einer besseren Patient*innenversorgung führen.
Welche Rolle spielt bei dem Projekt denn die Uni Greifswald?
Es ist wichtig, dass wir das Konstrukt des Geschlechts in seiner Komplexität begreifen. Das bedeutet, dass wir nicht nur die biomedizinische Sichtweise berücksichtigen, sondern auch etwa die sozialwissenschaftliche. So kann das soziale Geschlecht, also “gender”, eine wesentliche Rolle in der Beziehung zwischen Ärzt*in und Patient*in spielen. Das sehe ich auch in meinem Fachgebiet. Es gibt Studien, die belegen, dass erhebliche geschlechtsspezifische Unterschiede in der Versorgung von Menschen mit einer chronischen Nierenkrankheit, kurz CKD, bestehen. Frauen erhalten seltener eine CKD-Diagnose und werden entsprechend nicht an die Nephrologie überwiesen. Die Ursache liegt dabei nicht im biologischen, sondern im sozialen Geschlecht. Umso wichtiger, dass wir im Verbundprojekt mit der Uni Greifswald eine breitere Herangehensweise gewährleisten. So können sogenannte Gender-Scores erarbeitet werden, die die Erfassung von kulturellen, gesellschaftlichen und psychologischen Faktoren abdecken.
Und solche Gender-Scores könnten dann diesen blinden Fleck in der Grundlagenforschung beseitigen?
Zumindest streben wir einen Kulturwandel in der Grundlagenforschung an, indem wir Wissenschaftler*innen in der frühen Karrierephase zu diesem Thema sensibilisieren. Auch im Rahmen von Datennutzungsanträgen oder strukturierten Forschungsanträgen könnte an den Aspekt des Geschlechts erinnert werden. Wir möchten Mechanismen wie Beratungsangebote einführen. Zu diesem Zweck arbeiten wir deshalb auch sehr eng mit der Graduiertenakademie der Uni zusammen. Zunächst einmal werden wir aber einen Status Quo innerhalb der UMG erfassen.
Soll heißen?
Wir werden demnächst alle wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen, Arbeitsgruppenleitungen und auch Professor*innen dazu befragen, inwiefern das Geschlecht als Analysevariable im Rahmen von Forschungsarbeiten erfasst wird. Die Befragung soll auch die Einstellungen und Erfahrungen mit geschlechtsspezifischen Analysen in der Medizin erfassen. Nach unserem Auftakttreffen Anfang März wird das der erste Schritt unseres InkE-Projekts sein.
Wir danken für das Gespräch und wünschen viel Erfolg!
Unter der Leitung von Prof. Dr. Sylvia Stracke beteiligen sich an dem Projekt „Inklusive Exzellenz in der Medizin“ (InkE) verschiedene Akteur*innen aus der Universitätsmedizin Greifswald (Klinik für Innere Medizin A, Medizininformatik, Medizinische Psychologie, Klinik für Neurologie, Klinik für Unfallchirurgie, Medizinische Biochemie und Molekularbiologie, Dermatologie, Medical Informatics Laboratory) sowie der Universität Greifswald (Graduiertenakademie, Interdisziplinäres Zentrum für Geschlechterforschung (IZfG), Gleichstellungsbeauftragte, Institut für Anglistik und Amerikanistik, Historisches Institut, Institut für Deutsche Philologie). Gefördert wird InkE vom BMBF über einen Zeitraum von 5 Jahren mit insgesamt 1,5 Millionen Euro. Es ist bundesweit das einzige Forschungsprojekt dieser Art.